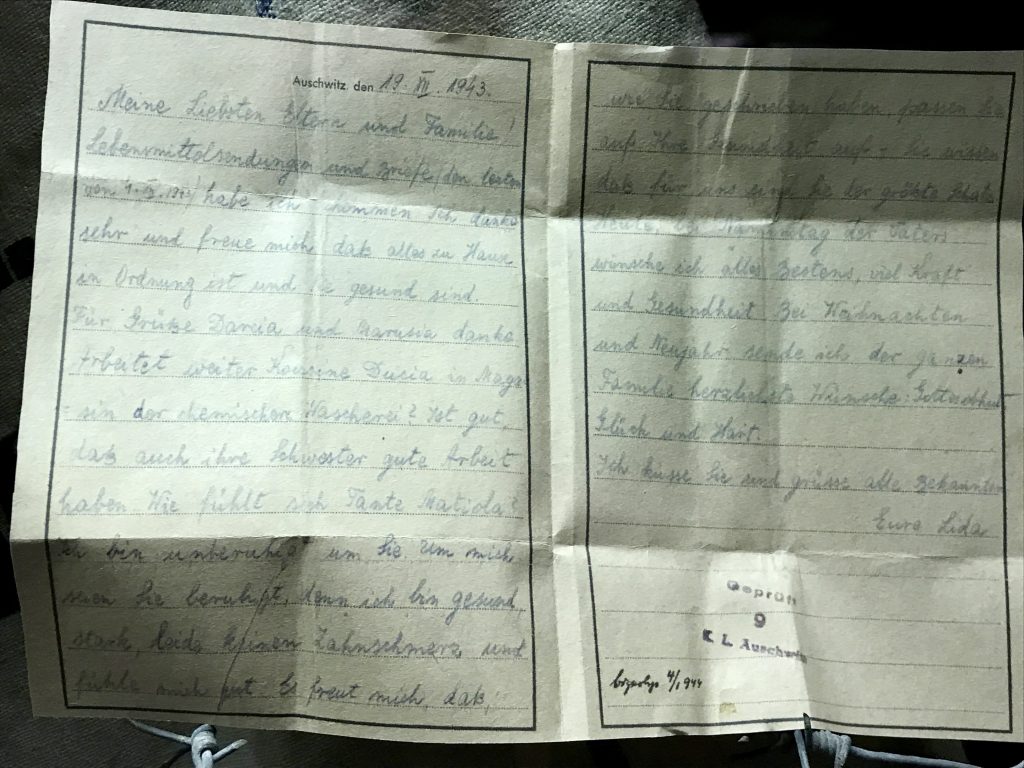Das Wetter ist immer noch schön, ein Sommerende, das sich lange hinzieht. Das Sophienkloster ist ein Hort der Ruhe und die Kathedrale eine Pracht mit ihren grünen und goldenen Kuppeln, ihren byzantinischen Mosaiken. Welche Worte könnten eine Vorstellung von der andächtigen Atmosphäre orthodoxer Kirchen geben — sogar der größten unter ihnen? Das wenige Licht lädt zum Gebet ein, zum Rückzug in das eigene Innere. Zudem enthält diese Kirche eine andere, Sankt-Michael, die unter Stalin zerstört wurde, einem offiziellen Gebäude weichen musste und schließlich nach der Unabhängigkeitserklärung wieder aufgebaut wurde. Mosaiken und Fresken konnten gerettet werden und lagern nun in der nahen Kathedrale. Sankt-Michael ist nicht weit vom Maidan entfernt, und an einem Abend während der Revolution klopften in die Enge getriebene Demonstranten an der Tür des Klosters — die, eingelassen in diese lange weiße Mauer, winzig scheint. Die Mönche öffneten ihnen und verschlossen sie dann vor den Polizisten. Oberhalb des Maidan — jenes langen Platzes, der 2013 zum Symbol wurde und von der Chreschtschatyk, eine der schönsten Straßen Kiews durchquert wird — erinnern Fotos an die Toten dieser Revolution. In der Ukraine scheint die Fotografie die Kunst der Totenzählung zu sein.

Chreschtschatyk
© Cécile Wajsbrot
Wir treffen Maria, eine Bibliothekarin im Goethe-Institut, zu einem Auf-und-Ab-Spaziergang — Kiew ist eine Hügelstadt — durch das Podil-Viertel mit seinen bunten Häuschen, früher ein armes Viertel mit engen Gassen — die fürstliche Stadt war auf der Anhöhe errichtet worden —, das heute ein Lieblingsviertel der Künstler geworden ist. Wie viele Menschen in Kiew sind woanders her gekommen? Von der Krim, dem Donbass, manche schon vor der Annexion oder dem Krieg, andere dann geflüchtet, mit ihrer Familie oder jemanden zurücklassend. Es gibt heute keinerlei Flugverbindungen mehr zwischen der Ukraine und Russland. Von Kiew nach Sebastopol fährt kein Zug mehr — man muss vor der Grenze aussteigen und einen Bus nehmen. Und beim Telefonieren muss man die russische Vorwahl wählen.

© Anne Weber
Nach dem Mittagessen im Selbstbedienungslokal Puzata Hata — wo die Gerichte ausliegen, die meine Großmutter unter anderen Namen zubereitete, Palmeni und Wareniki statt Kreplach, Bramboracka statt Latkes, nur der Borschtsch heißt in allen Ländern Borschtsch — gehen wir ins Tschernobyl-Museum. Ein Nebenfluss des am Fuße dieses Hügels fließenden Dnjepr ist der Prypjat, an dem das Kraftwerk und der — nun Geisterstadt gewordene — Ort desselben Namens liegt, dessen kurzem — sechzehn Jahre langem — Leben einer der Säle des Museums gewidmet ist. Die Funktionsweise des Kraftwerks, die weißen Uniformen der mit den ersten Notmaßnahmen Betrauten, die ungeeignete Kleidung der Feuerwehrmänner und immer wieder Fotos der an diese seltsame Front Geschickten, alles ist da, erhellt von den Erklärungen einer großartigen Führerin. Am Ende des Wegs die Solidaritätserklärungen der Japaner noch aus der Zeit vor Fukushima. Und eine Karte, auf der die noch funktionierenden Atomkraftwerke aufleuchten. Viele davon in Frankreich natürlich; und zugleich zeigt die Bildschirm-Animation, wie die Tschernobyl-Wolke sich ausbreitete, und beweist, dass diese keineswegs Frankreich verschont hat, wie öffentliche Beteuerungen es damals glauben machen wollten und wie es viele französische Besucher offenbar auch heute noch glauben. Tschernobyl — hundert Kilometer von Kiew entfernt. Zahlreiche Einwohner von Prypjat wurden in die Hauptstadt evakuiert. Mehrere Hunderte sind wieder in die verbotene Zone zurückgezogen — alte Frauen vor allem, die ihr Leben zu Hause beenden wollten. Beim Betrachten der hintereinander aufgehängten Ortsschilder fortan verbotener Städte und Dörfer, deren Rückseite mit den durchgestrichenen Ortsnamen beim Herausgehen zu sehen sind, fiel mir das während des Ersten Weltkriegs zerstörte Dorf Fleury ein, das unterhalb des Beinhauses von Douaumont liegt und das von einem Wald überwuchert ist, dessen Wege die ehemaligen Straßennamen tragen, und ich musste an die Zeugenberichte denken, die Swetlana Alexijewitsch in ihrem schönen Buch über Tschernobyl gesammelt hat — es ist ein Krieg, bei dem der Feind unsichtbar ist.